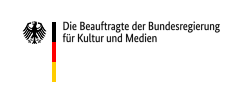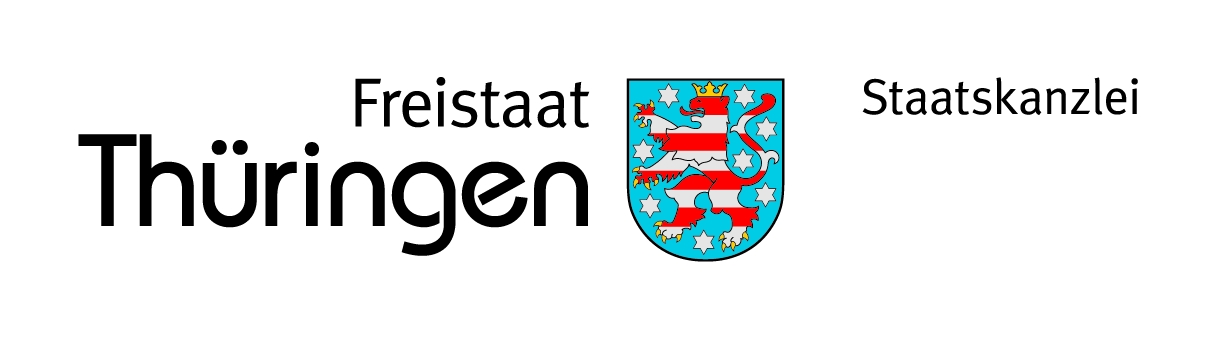Manche Museumsobjekte sind die reinsten Plaudertaschen: Offen tragen sie Geschichte und Geschichten vor sich her und erzählen vermittels Malerei, Schnitzereien oder Gravierungen von Vergangenem. Das vorliegende, kunstvoll mit Seidenapplikationen verzierte Elfenbeinkästchen aus dem späten 17. Jahrhundert aber gehört der verschwiegeneren Sorte von Museumsstücken an. Um seine Geschichte zu heben, bedarf es eines historischen Inventars. Das Inventar von 1717 (fol. 51r-v) verleiht dem hübschen Objekt eine abenteuerliche und schneidige Note:

Ein Rock und Weste mit Silber und Gold bordiret welche Ihro Hochfürst. Durch. Hertzog Friederich Unser gnädigster Herr getragen und angehabt, alß er anno 1696 bey dem exerciren, von einem Soldaten von des Hauptmann Kohlhausens Compagnie ohnweit des Cranbergs mit einer Kugel auf der Brust blessiret worden, nebst der Flinte, woraus solcher Schuß geschehen.
Ein Hellfenbeiner Käst. mit seidenen Blumwerck und Bildern ausgezieret, in wendig am Deckel mit einem Spiegel, das Kästgen aber mit rothen Taffent gefüttert, und mit Silbern Gallonen eingefast, worinnen ein güldener Knopff von Ihrer Hochfürst. Durch. beniembten Rock nebst der Kugel womit höchst gedachte Hochfürst. Durch. geschoßen worden.

Das Elfenbein-Kästchen gehört zu einem Ensemble von Memorabilia, die an einen glimpflich ausgegangenen Unfall Herzog Friedrichs II. von Sachsen-Gotha-Altenburg erinnern sollen. Spätestens seit 1717 wurden Kugel, Knopf, Kleidung und Kästchen in der Friedenstein’schen Kunstkammer aufbewahrt. Im Rahmen von Recherchen zu Objekten, die sich der historischen Kunstkammer auf Schloss Friedenstein zuordnen lassen, stieß ein Team von Wissenschaftlern auf das Kästchen.
Bei dem Objekt handelt es sich eigentlich um ein Toilette- oder Schreibkästchen mit Spiegel und herausnehmbarem Einsatz, das für die Aufbewahrung der Erinnerungsstücke umgenutzt wurde – wegen des Liebespaar-Motivs auf dem Deckel liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein Verlobungsgeschenk von Friedrich II. an seine Frau Magdalena Augusta handelt.

Während die Objektgruppe im späteren Kunstkammer-Inventar von 1764 sowie im Kunstkabinett-Verzeichnis von 1830 noch zusammen genannt wurde, waren schon im Inventar von 1840 Rock und Weste wegen Mottenfraß als aussortiert gekennzeichnet. Das Elfenbein-Kästchen verlor im 19. Jahrhundert weitgehend seine künstlerische Bedeutung und wurde in den Kunstkabinett-Inventaren von 1840 und 1858 sowie im Inventar des Herzoglichen Museums von 1879/1890 nicht mehr beschrieben. Es wird nur noch nebenbei als Behältnis für die eigentlichen sammlungswürdigen Objekte – Gewehrkugel und Knopf – erwähnt. Die Kugel ist inzwischen verloren gegangen, vom Knopf sind im Kästchen noch einige metallische Restfäden erhalten, die auf einen Posamentenknopf schließen lassen.
Die zur Objektgruppe gehörenden Kleidungsstücke wurden (trotz angeblichem Mottenfraß!) nach 1840 verkauft und gelangten über den Nürnberger Kunsthandel 1879 in das Germanische Nationalmuseum. Dort sind sie noch heute Teil der Textilsammlung.
Agnes Strehlau und Susanne Hörr für die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha