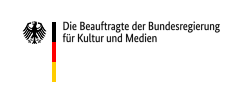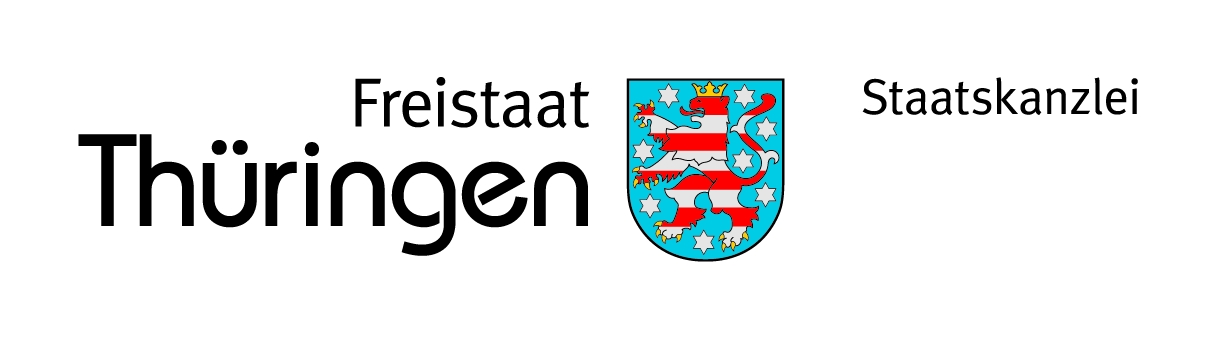Höchste Konzentration ist gefragt bei der Dachsanierung am Westflügel von Schloss Friedenstein. „Fast nichts können wir hier in Serie machen, wir diskutieren vor Ort jeden einzelnen Balken“, sagt Bauingenieurin Sabine Jeschke, die für die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten vor Ort die Baumaßnahmen koordiniert. Auch wenn die vorher ausgearbeiteten Planungen sehr detailliert sind und so ziemlich genau der Aufwand abgeschätzt werden konnte, gibt es doch immer wieder Detailfragen zu klären, wenn die Handwerker im Dachstuhl stehen und die Säge ansetzen wollen. „Substanz geht vor, lautet dabei unsere Devise, und wir ringen wirklich um jeden originalen Balken des barocken Dachstuhls.“ Ein Monument wie Schloss Friedenstein ist eben nicht nur ein Zeugnis der Residenzkultur, sondern auch ein technisches Denkmal. Nur weil die Bautechnologie des 17. Jahrhunderts funktionierte, konnte das Schloss die letzten 350 Jahre stabil überstehen.

Damit das auch nach der Sanierung noch erkennbar ist, beraten Denkmalexperten, Holzspezialisten, Statiker und Handwerker regelmäßig vor Ort die nächsten Schritte. Das sind aber keine Plauderstündchen, sondern zielgerichtete Abstimmungen, die Klarheit schaffen und Zeit sparen helfen. Denn so komplex wie die Aufgabe ist auch die Fachsprache, mit der sich die Experten vor Ort verständigen. Die Stichworte „Pfette“ oder „Sparren“ und „stehendes Blatt“ oder “liegendes Blatt” mit einer knappen Maßangabe genügen, und der versierte Zimmermann weiß, was er zu tun hat.

Es sind vor allem die Knotenpunkte und Verbindungen, auf die sich die Handwerker konzentrieren müssen. Ziel ist es, die Dachkonstruktion wieder so tragfähig zu machen, wie sie zur Zeit ihrer Errichtung gewesen ist. Dass in dieser Hinsicht einiges im Argen lag, war vor Sanierungsbeginn auch für das ungeübte Auge leicht zu erkennen. Morsches Holz, gelöste Holzverbindungen, manchmal sogar Lücken in der Konstruktion und durchgebogene Deckenbalken – „an manchen Stellen hielt der Dachstuhl wohl nur noch aus Gewohnheit“, resümiert Sabine Jeschke. Die Ursachen für die Schäden sind dabei vielfältig, sie reichen von Hausschwamm, Überlastung und nachträglichen Veränderungen bis hin zu schlichter Materialermüdung an den besonders beanspruchten Stellen.

Schwerpunkt der Arbeiten sind die Auflager auf den Außenwänden des Schlosses. Das ist ein bauphysikalisch besonders sensibler Bereich, und zugleich kommt es gerade dort besonders auf Stabilität an. Hier muss die ganze Last des Dachs aufgefangen und nach unten abgeleitet werden. Hier treffen aber auch mit Holz und Mauerwerk unterschiedliche Materialien aufeinander, was das Auftreten von Feuchte begünstigt. Wenn dann noch das Dach undicht ist, können Schwächungen am Holz leicht zu schwerwiegenden statischen Problemen führen.

Zur Behebung dieser Schäden kommen hauptsächlich die seit Jahrhunderten bewährten Zimmermannstechniken zum Einsatz. Schadhafte Balkenköpfe beispielsweise werden entfernt und wieder angeschuht, wobei das stehende Blatt – mit aufrecht stehenden Schnittkanten – verhindern soll, dass sich an der Reparaturstelle später die Balken biegen. Instandgesetzte Dachsparren werden mit dem sogenannten Fersenversatz in die Deckenbalken gefügt, mit einem einfachen Zahn haken sie sich aufgrund ihrer Last im waagerecht liegenden Holz fest. Mit dem möglichst weitgehenden Rückgriff auf die vorgefundenen Technologien und dem Schwerpunkt Substanzerhalt wird das Schloss nicht nur äußerlich erhalten, sondern auch als Denkmal der Baukultur gepflegt – bis hin zur Pflege bewährter historischer Handwerkstechniken, die oft bestechend einfach und funktional sind, aber dennoch in Vergessenheit zu geraten drohen.
Franz Nagel für die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten