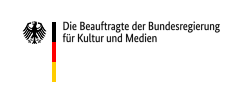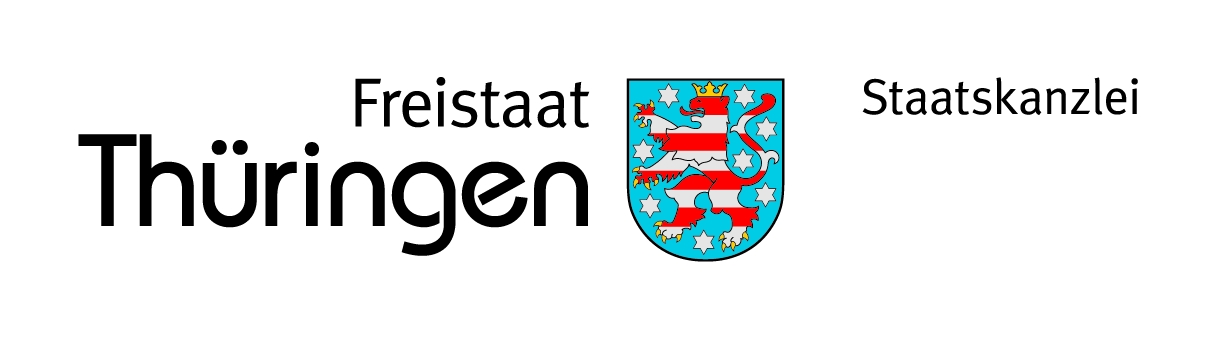In der Mitte des 18. Jahrhunderts trat die landschaftliche Gartenkunst von England aus ihren Siegeszug auf dem europäischen Festland an. Gotha gehörte dabei zu den Vorreitern. 1769 ließ Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg einen Gartenkünstler ans Werk gehen, den er im Mutterland des Landschaftsparks engagiert hatte – John Haverfield jr., ausgebildet in den bis heute legendären Kew Gardens bei London.

Ausschlaggebend war die für fürstliche Sprößlinge obligatorische Prinzenreise, die Ernst unmittelbar zuvor absolviert hatte. Unter anderem führte sie ihn an den englischen Hof, mit dem die Gothaer Herzogsfamilie verwandtschaftlich verbunden war. Die Gärten und Parks in der Umgebung Londons müssen bei dem Prinzen tiefe Eindrücke hinterlassen haben, hatten sie doch einen vollkommen anderen Charakter als die Anlagen, die man an Höfen auf dem Festland gewohnt war. In Gotha selbst war es noch keine 20 Jahre her, dass man einen streng geometrischen Orangeriegarten neu angelegt hatte.

Anlagen wie Stowe und Kew atmeten einen ganz anderen Geist. Zu den Stars dieser Gartenrevolution gehörte Lancelot Brown, dem sein Erfindungsreichtum den anerkennenden Beinamen Capability einbrachte. Architektonisches machte sich rar, und die Gartenkunst setzte sich ein ideales Naturbild zum Ziel. Geometrie und Symmetrie wichen naturnahen Bodenformationen, von den Wegen erschlossen sich dem Flaneur immer wieder neue reizvolle Szenerien, die wie Landschaftsbilder komponiert waren. Wiesenflächen, eindrucksvolle Baumgruppen und facettenreiche Gehölze waren nun die künstlerischen Mittel.

Die Königsdisziplin blieb wie zuvor der Umgang mit Wasser – allerdings nicht mehr in Form von gemauerten Kanälen und imposanten Springbrunnen. Unregelmäßig angelegte Seen und Wasserläufe sollten den Parks besonderen Reiz verleihen. So machte Haverfield auch in Gotha den See zum Ausgangspunkt des Englischen Gartens. Zwei Jahre lang ließ er den See ausschachten und das Bodenprofil in seiner Umgebung modellieren. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Toteninsel, die später als nur per Boot erreichbare Begräbnisstätte diente. Sie ist so geschickt im See platziert, dass dessen Dimensionen nie auf einen Blick zu erfassen sind.

Den zweiten Schwerpunkt der Arbeiten bildete das Pflanzen von Bäumen. Mit großem technischen und logistischen Aufwand wurden alte Bäume mit charakteristisch ausgeprägten Kronenformen herbeigeschafft, um nicht Jahrzehnte auf das angestrebte Parkbild warten zu müssen. Teils zu Gruppen, teils zu dichten Gehölzstreifen komponiert, gaben sie den malerischen Parkszenerien gezielt ihr elegisches Gepräge. Zu erleben sind diese artifiziellen Naturbilder bei einem Rundgang auf dem Belt Walk, dem sorgfältig in den Randbereichen des Parks angelegten Rundweg. Gestalterischer Höhepunkt ist der 1777 fertiggestellte Merkurtempel am Nordufer des Sees.

Ernst II. stellte sich mit dem Englischen Garten an die Spitze der gartenkünstlerischen Wende, die Ausdruck umfassender ideengeschichtlicher Umwälzungen war. Der ruhige und ernsthafte Klassizismus löste die an Symmetrie und Pracht orientierten Formen des Barock ab, die Natur wurde zum Vorbild für künstlerische Nachahmung. Praktisch parallel zum Englischen Garten in Gotha entstand der heute zum Weltkulturerbe zählende Wörlitzer Park – auf der Grundlage gleicher Ideale markieren beide den Aufbruch in eine neue Epoche.
Franz Nagel für die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten