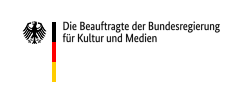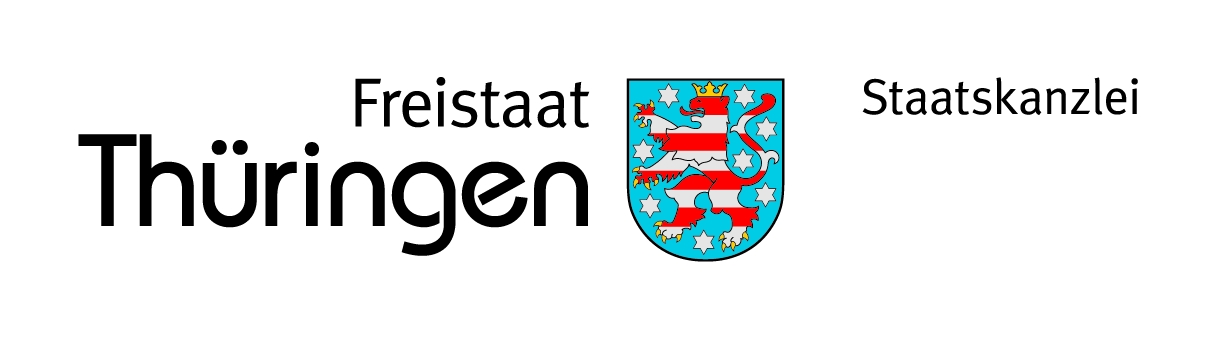Im November 2018 schlugen die Statiker Alarm. Eine Sichtung des Dachstuhls im Orangenhaus nach dem Entfernen von Verkleidungen ergab ein verheerendes Bild von Lasten und Kräften. Seither ist das Gebäude vorsorglich gesperrt. Wenn alles gut geht, ist es mit diesem unerfreulichen Zustand bald vorbei. Bis Ende Juni sind nun Zimmerleute am Werk und stabilisieren die Holzkonstruktion.

Vielfältige Einflüsse haben die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt. Neben den üblichen Umwelteinflüssen wie Nässe und Schädlingen gab es Eingriffe in den Jahrhunderten nach der Errichtung. Zum Beispiel muteten nachträglich eingebaute Schornsteine dem Dachstuhl Lasten zu, die ursprünglich nicht eingeplant waren. Um das auszugleichen, baute man zwar zusätzliche Streben ein, schwächte durch die dafür notwendigen Sägeschnitte aber die ursprüngliche Konstruktion noch zusätzlich.
Jetzt werden die schwachen Verbindungen so verstärkt, dass sie wieder kraftschlüssig funktionieren. Vor allem geht es darum, die Lasten der Raumdecken zuverlässig auf die Außenwände abzuleiten. Dafür hatte der Architekt Gottfried Heinrich Krohne im 18. Jahrhundert ein Hänge-Spreng-Werk errichten lassen, das die Deckenbalken im Dachstuhl aufhängt und damit große stützenlose Räume ermöglicht.

Zunächst war befürchtet worden, dass die Decken für die Sicherung von unten abgestützt werden müssen. Dies wäre ein erheblicher finanzieller Aufwand gewesen und hätte die Innenräume auf Jahre hinaus unbenutzbar gemacht. Denn die grundlegende Sanierung ist in einer späteren Phase des 60-Millionen-Euro-Projekts vorgesehen. Wenn die nun beginnende Verstärkung des Dachstuhls gelingt, kann das Orangenhaus bald wieder vorübergehend genutzt werden. Beeinträchtigungen wird es dann nur in Gestalt einzelner Netze unter den Decken geben. Sie sollen Putzteile auffangen, die sich infolge der veränderten Spannungsverhältnisse möglicherweise lösen könnten.
Franz Nagel für die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten